1. Prämissen bei Freuds und Jungs Arbeiten
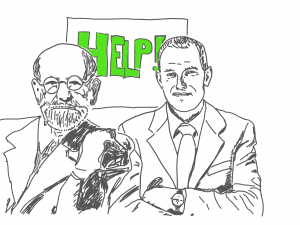 Sigmund Freud und Carl Gustav Jung prägten mit ihren Arbeiten das psychologische Denken des frühen 20. Jahrhunderts. Beide entwickelten Modelle, die darauf abzielten, das menschliche Verhalten aus inneren psychischen Strukturen heraus zu erklären:
Sigmund Freud und Carl Gustav Jung prägten mit ihren Arbeiten das psychologische Denken des frühen 20. Jahrhunderts. Beide entwickelten Modelle, die darauf abzielten, das menschliche Verhalten aus inneren psychischen Strukturen heraus zu erklären:
- Freud: Freud postulierte, dass das menschliche Verhalten aus der Dynamik zwischen dem Es (triebhafte Impulse), dem Ich (rationales Selbst) und dem Über-Ich (moralische Normen) entsteht. Unbewusste Konflikte zwischen diesen Instanzen bestimmen laut Freud sowohl psychische Störungen als auch alltägliches Handeln. Seine therapeutischen Ansätze konzentrierten sich auf die Aufdeckung und Bearbeitung dieser inneren Spannungen, vor allem durch Introspektion und Analyse.
- Jung: Jung erweiterte Freuds Konzept, indem er universelle Archetypen einführte – psychische Grundmuster, die tief in der menschlichen Psyche verankert seien. Diese Archetypen wie der „Held“ oder die „Anima“ sollten kollektive, angeborene Strukturen darstellen, die das Denken und Handeln beeinflussen. Auch bei Jung lag der Fokus auf der Bearbeitung innerer Konflikte, insbesondere durch die Integration des „Schatten“ genannten unbewussten Anteils in die bewusste Psyche.
Beide Theorien teilen die Annahme, dass das Innere des Menschen – seien es Konflikte oder tiefenpsychologische Muster – der zentrale Ort für Veränderung ist. Umweltfaktoren werden lediglich als Auslöser oder Verstärker betrachtet, nicht jedoch als wesentliche Gestaltungsgröße.
2. Prämissen und Erkenntnisse der Theorie der prädiktiven Verarbeitung
Die Theorie der prädiktiven Verarbeitung (predictive processing), deren wesentlicher Vertreter z.B. Andy Clark ist, bietet ein deutlich moderneres und empirisch fundiertes Modell des menschlichen Geistes. Sie basiert auf Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft, Kognitionswissenschaft und Psychologie und beschreibt das Gehirn als dynamisches Vorhersagesystem.
- Das Gehirn als Vorhersagemaschine: Im Kern der Theorie steht die Idee, dass das Gehirn ständig Vorhersagen über die Welt macht und diese mit eingehenden sensorischen Informationen abgleicht. Verhalten entsteht durch die aktive Anpassung dieser Vorhersagen an die Umwelt, nicht durch starre innere Strukturen.
- Flexibilität statt starrer Modelle: Im Gegensatz zu den psychoanalytischen Konzepten geht die Theorie davon aus, dass das Gehirn keine universellen, festen Strukturen wie Archetypen oder Instanzen besitzt. Stattdessen entwickelt es flexible, kontextabhängige Vorhersagemodelle, die sich ständig an neue Erfahrungen anpassen.
- Primat der Umwelt: Veränderungen im Verhalten oder Erleben resultieren laut prädiktiver Verarbeitung nicht primär aus introspektiver Arbeit, sondern aus der Interaktion mit der Umwelt. Das Gehirn passt seine Modelle kontinuierlich an die Umweltbedingungen an, wodurch Kontext und soziale Dynamiken zentrale Einflussgrößen für Veränderung sind.
Diese Erkenntnisse revolutionieren das Verständnis von menschlichem Handeln und Veränderung: Sie verschieben den Fokus von der introspektiven Bearbeitung innerer Strukturen hin zur Analyse und Gestaltung von Umweltfaktoren.
3. Argumentation: Warum die prädiktive Verarbeitung Freud und Jung überflüssig macht
Die Theorie der prädiktiven Verarbeitung ist Freud und Jung nicht nur wissenschaftlich überlegen, sondern bietet auch praxisnähere Ansätze für Veränderung. Ihre Vorteile lassen sich in drei zentralen Aspekten zusammenfassen:
Zunächst hebt die Theorie hervor, dass das menschliche Gehirn hochgradig dynamisch und anpassungsfähig ist. Während Freud und Jung von relativ stabilen inneren Strukturen ausgingen, zeigt die prädiktive Verarbeitung, dass das Gehirn flexibel auf Umweltveränderungen reagiert und kontinuierlich neue Modelle generiert. Diese Perspektive widerspricht der Annahme, dass Verhalten durch universelle Muster wie Archetypen oder unveränderliche Instanzen geprägt ist.
Zudem verdeutlicht die prädiktive Verarbeitung, dass nachhaltige Veränderungen nicht aus der introspektiven Bearbeitung unbewusster Konflikte resultieren, sondern aus der aktiven Neugestaltung der Umwelt. Ein Klient mit Motivationsproblemen benötigt oft nicht die Aufarbeitung seiner Kindheit, sondern eine veränderte Umgebung, die neue Verhaltensmuster fördert. Dies könnte etwa die Einführung klarer Strukturen, sozialer Verstärker oder veränderter Kommunikationskanäle sein.
Schließlich basiert die Theorie auf einem breiten Fundament empirischer Forschung, während Freud und Jung ihre Modelle weitgehend aus Einzelfallstudien und introspektiven Beobachtungen entwickelten. Die prädiktive Verarbeitung wird durch neurowissenschaftliche Experimente und Erkenntnisse aus der Kognitionsforschung gestützt, was sie sowohl inhaltlich fundierter als auch praxisnäher macht.
Für die Beratungspraxis ergeben sich daraus klare Handlungsempfehlungen. Statt sich auf introspektive Ansätze zu konzentrieren, sollten Coaches und Berater den Fokus darauf legen, die Umweltbedingungen eines Klienten zu analysieren und gezielt zu verändern. Konkrete Beispiele sind:
- Gestaltung von Arbeitsumgebungen: Ein Mitarbeiter, der sich durch ständige Unterbrechungen gestresst fühlt, könnte von klaren Kommunikationsregeln und physischen Veränderungen im Büro profitieren.
- Soziale Interaktionen: Ein Klient, der sich in Konfliktsituationen unwohl fühlt, könnte durch gezielte Anpassung seiner sozialen Rollen oder durch Team-Retrospektiven unterstützt werden.
- Iterative Ansätze: Kleine, konkrete Änderungen an sozialen oder physischen Kontexten können getestet, reflektiert und angepasst werden. Dieses Vorgehen entspricht dem iterativen Prinzip der prädiktiven Verarbeitung und führt zu nachhaltigen Veränderungen.
Fazit und unsere Erfahrungen
Die prädiktive Verarbeitung repräsentiert einen Paradigmenwechsel, der die tiefenpsychologischen Theorien von Freud und Jung klar hinter sich lässt. Ihre wissenschaftliche Fundierung und ihr Fokus auf die Wechselwirkung zwischen Gehirn und Umwelt machen sie nicht nur aktueller, sondern auch praktikabler für die moderne Beratung und Therapie. Während Freud und Jung wichtige historische Beiträge lieferten, werden ihre Modelle heutigen wissenschaftlichen Standards nicht mehr gerecht. Die prädiktive Verarbeitung bietet dagegen eine zeitgemäße Grundlage, um Veränderungsprozesse zu gestalten. Sie zeigt, dass nachhaltige Veränderung nicht im Inneren beginnt, sondern in der Interaktion mit der Umwelt. Für Beratung und Coaching bedeutet dies, den Fokus auf die Anpassung von Kontexten und sozialen Dynamiken zu legen, um neue Verhaltensweisen zu fördern. Die Arbeit mit introspektiven Ansätzen sollte in diesem Rahmen eine unterstützende, nicht zentrale Rolle spielen. Die Zukunft von Coaching und Beratung liegt in der Nutzung dieses wissenschaftlich fundierten, umweltzentrierten Ansatzes, der effektivere und nachhaltigere Veränderungen ermöglicht.
Wir versuchen in unserer Arbeit am xm-institute diese neuen Erkenntnisse der Neurowissenschaften kontinuierlich intensiv zu nutzen und in unsere Leadership Development Programme konsequent einfließen zu lassen. Bei Führungskräften in den Programmen erleben wir hier umfassende Zustimmung, auch bei solchen, die bereits in vielen klassischen Leadership Development Programmen waren, die auf inneren Bildern und mentalen Modellen aufbauen (Arbeit am Inter Self). Dies und einzelne Rückmeldungen über die Wirksamkeit der anderen Sicht im Führungsalltag stimmen uns ebenfalls zuversichtlich. Auf Seiten beauftragender HR Bereiche ist die Überzeugungsarbeit gerade bei traditionell psychologisch geprägten Entscheidern höher, wenn es darum geht, moderne Komplexitätstheoretische und Neurowissenschaftliche Ansätze als Fundament zu nutzen.
Referenzen
Clark, A. (2015). Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind. Oxford University Press.
Clark, A. (2024). The experience machine: How our minds predict and shape reality. Random House.
Freud, S. (2023). Sigmund Freud: Das Ich und das Es. DigiCat.
Jung, C. G. (2014). The archetypes and the collective unconscious. Routledge.


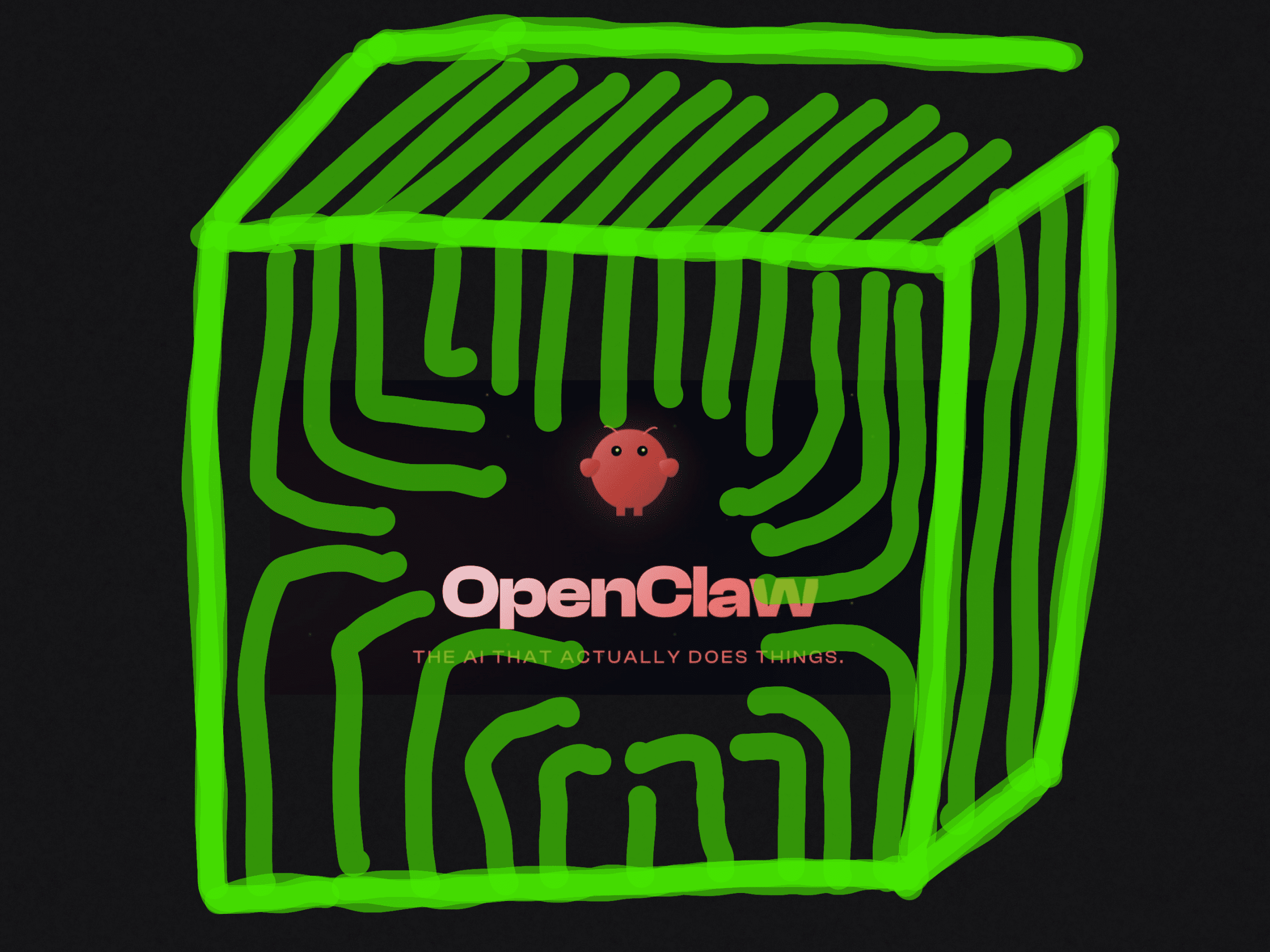



Leave A Comment